Pädagogische Konzeption
Die besondere Aufgabenstellung eines Heimes, das in öffentlichem Auftrag Kinder und Jugendliche außerhalb ihrer Familien erzieht, schafft ein Spannungsfeld, das durch zwei schwer vereinbare Pole gekennzeichnet ist: es ist soziale Einrichtung und natürlicher Lebensraum zugleich. Je kleiner das Heim und je persönlicher die Beziehungsstrukturen innerhalb des Heimes sind, um so weniger tritt die Realität der Institution in Erscheinung. Jugendliche haben ein Recht auf einen normalen Alltag, auch und gerade dann, wenn der familiäre Alltag in die subjektive Katastrophe einer Heimunterbringung geführt hat.
Die Fachlichkeit der Institution drängt sich dem Alltag nicht auf, sie durchdringt sie als Tiefenstruktur: als Beziehungskompetenz der Mitarbeiter, als seismographische Aufmerksamkeit für Fehlentwicklungen, in der Fähigkeit zur Krisenintervention, in Form von Orientierungshilfen aus eingefahrenen Verhaltensmustern heraus. Die Ebene, auf der das Spannungsfeld von Professionalität und gemeinsamem Alltag in Lebenswirklichkeit umgesetzt wird, ist die der Beziehung.
Das Team
Als privates Heim mit nur einer Gruppe sind wir nicht in hierarchische Einrichtungs- oder Trägerstrukturen eingebunden. Das eröffnet uns die Chance, das Beziehungsfeld im Heim nach unseren eigenen Vorstellungen zu gestalten. »Wir«: das ist ein sechsköpfiges Team, bestehend aus dem Heimleiterehepaar, das auf dem Heimgelände wohnt, und vier pädagogischen Mitarbeitern (hier wie im weiteren Text sind stets Mitarbeiter beiderlei Geschlechts gemeint). Die Form der Zusammenarbeit ergibt sich aus der Grundstruktur unserer Einrichtung: im Zentrum des institutionellen wie des persönlichen Beziehungsgeflechts steht das Heimleiterehepaar, das seine Hauptaufgabe darin sieht, aus den Rahmenbedingungen der Einrichtung ein Heim zu gestalten, das von den Jugendlichen als zweites zu Hause erlebt und angenommen werden kann.
Dazu gehört ganz wesentlich die Unterstützung durch die Mitarbeiter, die einen großen Teil der Beziehungsarbeit leisten und den Jugendlichen Beziehungsalternativen bieten. Die Voraussetzung dafür sind weitreichende Kompetenzen im Erziehungsalltag, eine offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Team und die Bereitschaft, Mitverantwortung für das Ganze zu tragen. Die verantwortliche Einbindung der Mitarbeiter in die Gestaltung des Zusammenlebens im Heim gewährleistet ein hohes Maß an personeller Stabilität, ohne die unsere pädagogischen Intentionen kaum umzusetzen wären.
Beziehung schafft Bindung
Der Begriff »Heimunterbringung« sagt wenig über die menschlichen Katastrophen aus, die am Ende diese eingreifende Form der Hilfe zur Erziehung zur Folge hatten. Er steht in aller Regel für das Scheitern einer Familiengemeinschaft. Das hinterlässt bei allen Beteiligten Spuren, in besonderem Maße bei den betroffenen Kindern und Jugendlichen, deren Persönlichkeitsstruktur noch in Entwicklung begriffen ist. Das Heim übernimmt in einem solchen Fall nicht nur den Erziehungsauftrag, dem die Eltern nicht mehr gerecht werden können; es muß darüber hinaus die Traumatisierungen auffangen und aufarbeiten, die mit diesem Prozess des Scheiterns und seiner Konsequenz, der Trennung von der Familie, einhergehen. Dem trägt der Gesetzgeber dadurch Rechnung, dass er in § 27 Abs. 3 SGB VIII pädagogische und therapeutische Leistungen bei der Hilfe zur Erziehung miteinander verknüpft.
Das beinhaltet einen hohen Anspruch, da pädagogische und therapeutische Haltung keineswegs deckungsgleich sind und vielfach in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen. Das Medium, in dem sie zusammengeführt und zur Wirksamkeit gebracht werden können, ist die persönliche Beziehung.
Nicht jede Beziehung hat das Zeug zum Therapeuticum. In der Regel werden Beziehungen spontan und unreflektiert geführt, spiegeln die gesellschaftliche Bandbreite sozialer Kompetenz, sind auf unterschiedlichste Weise emotional gefärbt und können – im schlechtesten Fall – ausgesprochen destruktiv wirken. Hier setzt professionelles Handeln an: Was immer ein Erzieher im Rahmen seines beruflichen Auftrags tut – er muss wissen, was er tut! Emotionale Beziehung und erzieherische Distanz, spontane Gefühle und mitlaufende Selbstreflexion, menschliche Offenheit und fachliche Verantwortung, Einfühlungsbereitschaft und kritische Begleitung: damit ist die Bandbreite an Beziehungsnuancen angedeutet, die ein guter Erzieher in seiner Person vereinigen und über die er situationsbezogen verfügen können muss.
Entscheidend dabei ist jedoch ein Wissen darum, dass Beziehungen nicht Selbstzweck sind. Hinter vielen emotionalen und Verhaltensproblemen verbergen sich frühkindliche Bindungsstörungen und daraus resultierende Reifungs- und Entwicklungsverzögerungen, die sich in auffälligem und nicht altersgemäßem Verhalten niederschlagen. Ist dies der Kern des Problems, so reicht ein erzieherischer Ansatz nicht aus, um die Problematik zu beheben. Nachholende Entwicklung und Schaffung von Bindungssicherheit sind dann notwendige Voraussetzungen, um Änderungen auch auf der Verhaltensebene herbeizuführen und die Chancen des jungen Menschen auf ein Leben in Eigenverantwortung gemäß seinen Neigungen und Fähigkeiten zu verbessern.
Umgesetzt wird diese fachliche Intention auf der Beziehungsebene. Hier entscheidet sich, ob eine erzieherische Intervention Machtverhältnisse durchsetzen soll oder die Notwendigkeit von Kooperation im gemeinsamen Alltag plausibel machen kann, ob sie motiviert oder zu Widerstand reizt, ob sie direktiv zu lenken versucht oder eigene Entscheidungsprozesse beim Jugendlichen fördert. Und damit entscheidet sich, ob die Wohngruppe zu dem sicheren Hafen werden kann, den ein Kind braucht, um verlorene oder nie erworbene Bindungssicherheit zu erwerben, die es als Basis für die Neuordnung seines inneren Lebens braucht.
Beziehung, die in diesem Sinne und damit im Sinne des Jugendhilfeauftrags wirken will, muss insbesondere bezüglich folgender Aspekte für Reflexion, für Selbst- und Fremdbeobachtung und fachliche Begleitung (Supervision) offen sein und als ständiger Lernprozess verstanden werden:
- gegenseitige Wertschätzung und gegenseitiger Respekt als Leitbild, an dem sich der Beziehungsalltag ständig zu messen hat;
- Bereitschaft zur Übernahme der Elternrolle im Rahmen des Erziehungsauftrages;
- reflektierter Umgang mit professioneller Nähe und Fähigkeit zu erzieherischer Distanz;
- Fähigkeit und Bereitschaft zur Selbstreflexion;
- Unterscheidung zwischen persönlicher und sachlicher Ebene;
- Beachtung von Übertragungs- und Gegenübertragungsphänomenen;
- bewusster Einsatz der eigenen Vorbildfunktion.
Den Rahmen für eine gezielte Nutzung der Beziehungsebene in diesem konzeptionellen Ansatz bietet das im Jugendhof Auenland praktizierte Bezugserziehersystem. Es setzt den Bindungsgedanken im institutionellen Rahmen der Einrichtung unmittelbar um
Reden, reden, reden – doch das Wann und Wie ist wichtig
Beziehung läuft auf mehreren Ebenen ab. Nonverbale Beziehungsaspekte (Mimik, Gestik, Regulierung von Nähe und Distanz, Körperkontakt) leisten einen außerordentlich wichtigen Beitrag zur Gestaltung der Beziehungsathmosphäre, sowohl in der Gruppe als auch in der Einzelbeziehung. Bereits auf dieser Ebene findet eine Weichenstellung statt: Jugendliche sollen und dürfen sich willkommen fühlen und werden auch nonverbal eingeladen, sich ihrerseits auf der Beziehungsebene zu öffnen.
Erst darauf aufbauend und in emotionaler Übereinstimmung mit der nonverbalen Ebene können Gespräche ihre Wirkung entfalten. Wenn sich die Beziehung gefestigt, wenn sich Vertrautheit eingestellt hat und Vertrauen gewachsen ist, wird die verbale Ebene die Leitfunktion bei der Beziehungsführung übernehmen. Dann verlagert sich der Beziehungsschwerpunkt auf die gemeinsame Bewältigung von Alltagsanforderungen, auf die Vermittlung von Orientierungshilfen und die Entwicklung realistischer Perspektiven. Um Normen und Regeln geht es da, um die bewusste Auseinandersetzung mit den verschiedenen sozialen Bezugssystemen, denen ein Jugendlicher angehört, um individuelle Orientierung und Planung, um die Bewältigung des Leistungsbereiches.
Gelegenheiten für Gespräche gibt es reichlich. Einmal pro Woche findet sich die Gruppe zur Hausversammlung zusammen. Die Teilnahme ist obligatorisch. Darüber hinaus ergeben sich ständig aus dem Alltagsgeschehen heraus Gelegenheiten und Anlässe, in wechselnden Zusammensetzungen und in unterschiedlicher Intensität über die verschiedensten Dinge zu reden.
Einen besonderen Stellenwert haben unter diesem Aspekt die gemeinsamen Mahlzeiten. Sie sind geselliges Beisammensein und Informationsbörse, bieten Gelegenheit zum Dampfablassen und zu Absprachen – und vor allem: sie geben Aufschluss über die Stimmungslage in der Gruppe wie auch einzelner Jugendlicher.
Wichtig ist: institutionalisierte wie spontane Gespräche sind eingebettet in einen Alltag, der geregelten Routinen ebenso Raum gibt wie individueller und gemeinsamer Freizeitgestaltung, der ausgelassene Albernheit ebenso trägt wie emotionale Durchhänger, der Rückzugsmöglichkeiten bereithält und Momente der Langeweile aufkommen lässt – einen unangenehmen Zustand, der nicht wegorganisiert, sondern den Jugendlichen als Erfahrung zugemutet wird, die sie mit sich selbst konfrontiert. Aufgabe der Erzieher ist es, dazusein und zu erkennen, wo Probleme, wo Notlagen deutlich werden, wo übersteuert oder verheimlicht wird, wo der Alltag Machtstrukturen unter Jugendlichen offenbart, um dann einzugreifen und das Gespräch zu suchen – oder zu fordern.
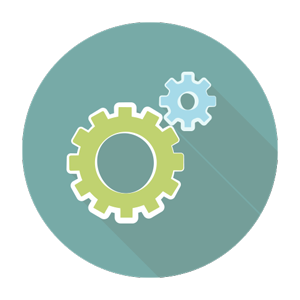
Ein Kapitel für sich: Konfliktbewältigung
Ein besonderer, besonders wichtiger und besonders heikler Anlaß für Gespräche sind Konflikte.
Konflikte nehmen in der Heimerziehung eine zentrale Stellung ein. Jugendliche übertragen, ob sie wollen oder nicht, Konfliktmuster aus der verunglückten Familieninteraktion auf das Heim. Das ist ebenso unvermeidlich wie belastend, für alle Beteiligten. Doch genau hier, in der Bewältigung der von den Jugendlichen provozierten und inszenierten Konflikte, liegt die Chance der Heimerziehung: wenn der Erzieher den Kern der vom Jugendlichen im Konflikt inszenierten Geschichte zu verstehen beginnt, kann er durch seine Reaktion, durch sein Verhalten dafür Sorge tragen, dass sie diesmal einen anderen Ausgang nimmt. Wenn dies oft genug geschieht und der Jugendliche die Erfahrung macht, dass die gemeinsame Bewältigung von Konflikten eine Beziehung nicht belastet, sondern sie im Gegenteil vertiefen kann, dann werden die Inszenierungen ihren Charakter verändern und im besten Fall ganz aufhören – der Jugendliche ist frei, neue Verhaltensweisen zu erproben.
In der Praxis der Konfliktbewältigung zeigt sich wie in keinem anderen Bereich die Qualität der Heimerziehung – und nirgendwo steht der Erzieher deutlicher auf dem Prüfstand. Hier gibt es weder Routine noch Rezepte, jeder Einzelfall erfordert die volle Präsenz des Erziehers und eine Reihe fachlicher Entscheidungen:
- Ist der Erzieher gefordert oder eher der Therapeut?
- Ist eine Einzel- oder eine Gruppenintervention angebracht?
- Interveniert er in der Situation oder holt er den Jugendlichen aus der Situation heraus?
- Lässt er erzieherische Konsequenzen folgen, oder liegt die richtige Entscheidung gerade darin, darauf zu verzichten und den Konfliktparteien Schutz durch einfühlsame Nähe zu bieten?
- Setzt er in der Konfliktsituation ein klärendes Gespräch durch oder vertagt er es im Hinblick auf die Aufnahmefähigkeit des Jugendlichen auf einen späteren Zeitpunkt?
- Und vor allem anderen: Wie geht er mit seiner eigenen Betroffenheit um?
Grundsätzlich gilt: Konfliktbewältigung kann nur dann zu einer Vertiefung der Beziehung und zu positiven Veränderungsprozessen führen, wenn eine Klärung der Konfliktsituation versucht wird und eine Lösung unter Wahrung des gegenseitigen Respekts zustande kommt. Weil Krisenbewältigung hohe Ansprüche an den Erzieher stellt und auch bei einem konstruktiven Verlauf immer die Gefahr gegenseitiger Verletzungen birgt, ist sie ständiger Gegenstand kollegialer Beratung und fachlicher Anleitung. Hier wird besonders deutlich, daß Heimerziehung einen hohen persönlichen Einsatz erfordert und auch dem Erzieher einen ständigen Lernprozess zumutet.
Bevor geredet wird …
Ein Heim ist eine Welt für sich. Eine schwierige Welt: hier soll »Hilfe zur Erziehung« geleistet werden, von Menschen, die dafür bezahlt werden, an Menschen, die davon nicht unbedingt begeistert sind. Wie lässt sich aus dieser konfliktträchtigen Grundsituation eine Basis schaffen, die alle Beteiligten akzeptieren können?
Die Antwort lautet: durch Regeln. Es sollte bei allen Beteiligten dieser eigenartigen Lebens- und Arbeitsgemeinschaft »Heim« ein möglichst hoher Grad an Klarheit darüber herrschen, was erlaubt ist und was nicht, wer im Zweifelsfalle das Sagen hat, was verpflichtend ist und was freiwillig, was nicht zur Debatte steht und worüber diskutiert werden kann.
Regeln müssen begründet, überprüft, diskutiert und gegebenenfalls verändert werden. Forum dafür sind – je nach Problemlage – die Erzieherkonferenz oder die wöchentliche Hausversammlung.
Für die Erfüllung des Jugendhilfeauftrags wie auch für das Zusammenleben im Haus ist es unabdingbar, Grundregeln zu formulieren, die nicht zur Disposition stehen (z.B. »Keine Gewalt«, »Kein Alkohol im Haus«, »Jeder beteiligt sich an den häuslichen Pflichten«, »Niemand betritt ein fremdes Zimmer ohne Zustimmung des Bewohners«, »Schulische/berufliche Pflichten gehen vor Freizeitgestaltung«).
Für die persönliche Entwicklung der jungen Menschen wie für das Gruppenklima muß aber auch Raum geschaffen werden für Prozesse der Mitgestaltung und Mitbestimmung. Dafür bieten sich die Gestaltung von Zeitstrukturen an (z.B.: Hausaufgabenbetreuung von wann bis wann?; altersabhängige Staffelung von Bettgehzeiten; wann ist am Wochenende Zapfenstreich, wie lange kann in der Früh ausgeschlafen werden?), Ausgangsregelungen, Planung von Freizeitaktivitäten oder die Verwendung finanzieller Mittel (Taschengeld, Bekleidungsgeld).
Die pädagogische Grundprämisse, die unseren Umgang mit Regeln bestimmt, lautet: Regeln können nicht unabhängig von Beziehung betrachtet werden; das Umsetzen und vor allem das Einfordern von Regeln geschieht immer schon auf der Beziehungsebene und macht einen Teil ihrer Qualität aus. So verstanden bietet der Umgang mit Regeln immer wieder Anknüpfungspunkte für Gespräche, die im Sinne persönlicher Entwicklung genutzt werden können.
Wenn Reden nicht hilft …
Sprache ist ein Medium, das in Wirksamkeit und Reichweite begrenzt ist. Das trifft in besonderem Maße für Kinder zu. Da es relativ spät in der Entwicklungsgeschichte eines Kindes erworben wird, fehlt den Wörtern die Verbindung mit den starken, noch undifferenzierten und hochwirksamen Gefühlen, die gerade die erste Lebensphase frühgestörter Kinder geprägt haben. Wenn diese Gefühle in Krisensituationen wieder wach werden, dann hilft kein Reden, sondern nur bedingungslose Annahme. Dann gilt es zu verstehen, dass Gespräche nicht aus Trotz verweigert werden, sondern dass frühkindliche und damit vorsprachliche Gefühle vorherrschen, die noch keinen sprachlichen Ausdruck gefunden haben. Eine angemessene Antwort des Betreuers auf eine solche Krisensituation muß ihrerseits die Ebene von Sprache und erzieherischen Konsequenzen verlassen können und Verstehen und Annahme verbunden mit der Sicherheit einer erwachsenen Haltung signalisieren.
Dann verlieren auch die gefürchteten »Ausraster« emotional labiler Kinder und Jugendlicher ihren Schrecken, und vor allem: eine solche Haltung bewahrt den Erzieher davor, auf Überreaktionen seinerseits mit einer Überreaktion zu antworten, eine Situation, die nur Verletzte zurücklässt. Gelingt es einem Erzieher hingegen, dem Kontrollverlust eines Kindes in der beschriebenen Weise zu begegnen, entsteht – Bindung.
Wenn die Wohngruppe auch als Raum solcher vorsprachlicher Erfahrungen erlebt werden kann, die eine nachholende Entwicklung ermöglichen, dann kann Sprache nach und nach auch in kritischen Phasen zum Medium von Verständigung und Orientierung werden. Diesen Prozeß im Einzelfall auszuloten, bindungsgestörte Kinder einerseits emotional nicht zu überfordern, ihnen in Krisensituationen aber immer auch andere Lösungsmöglichkeiten als Entwicklungsanreiz zu eröffnen und ihnen einen Zugang zu sprachlicher Verständigung zu ermöglichen: davon hängt in hohem Maße der Erfolg einer Maßnahme ab. Je nach Grad und Ausmaß der Störung wird der notwendige Zeitrahmen für eine Nachreifung differieren. Da es sich dabei nicht um Lernprozesse in einem kognitiven oder verhaltenstherapeutischen Sinn handelt, sondern in der Regel um Entwicklungsprozesse unter der Voraussetzung bereits verfestigter Fehlentwicklungen, die erst durch die Erfahrung von Sicherheit, Vertrauen und Kontinuität wieder aufzulösen bzw. zu korrigieren sind, muß sich der Zeithorizont der Maßnahme nach Art und Ausmaß der Störung richten.
Schulische Betreuung
Der schulischen Betreuung widmen wir besondere Aufmerksamkeit. Darauf, wie es einem Kind im Unterricht ergeht, haben wir nur mittelbaren Einfluss: im Klassenzimmer ist jede/r Jugendliche auf sich selbst gestellt. Andererseits schlagen aber Schulprobleme auf die Gesamtbefindlichkeit des Kindes durch und werden auch im Heim in Form von Reizbarkeit, gedrückter Stimmung, Leistungsunwillen usw. spürbar. Deshalb versuchen wir zum einen über einen regelmäßigen Kontakt zu den Lehrern das Geschehen in der Schule im Auge zu behalten, zum anderen im Heim mit Hilfe verbindlicher Hausaufgabenzeiten dafür Sorge zu tragen, dass die Kinder vorbereitet und damit unbelastet zur Schule gehen können.
Emotional labile Kinder sind den Anforderungen der schulischen Situation nicht immer gewachsen. Wem die Gefühle durchgehen, der kommt mit dem engen Regelwerk der Unterrichtssituation nicht mehr zurecht. Daher ist es in kritischen Situationen vorrangig, die Krise aufzufangen, und wenn dies im schulischen Rahmen nicht möglich ist, dann muß dies im vertrauteren Rahmen der Wohngruppe geschehen. In Absprache mit Schulleitungen und Lehrern werden dann Schulpausen eingelegt mit dem Ziel, den Schulalltag in einer stabileren Verfassung wieder aufzunehmen und ggbfls. die Ursachen der Krise zu klären.
Dies gilt auch bei Neuaufnahmen. Eine Heimunterbringung ist für das betroffene Kind immer eine dramatische Situation. Dem kann und muß in der Wohngruppe umfassend Rechnung getragen werden. Bevor das Kind der zusätzlichen Belastung des Schulwechsels ausgesetzt wird, sollte es in der Gruppe Fuß gefasst und eine Mindestmaß an Bindung zu seinen neuen Bezugspersonen aufgebaut haben. Mit der zeitversetzten Einschulung kann eine belastende Häufung von Stresssituationen vermieden und der Einstieg in die Maßnahme kindgerecht gestaltet werden. Auch über diese Praxis besteht fachliches Einvernehmen mit den zuständigen Schulleitungen.
In Weiler und Umgebung sind sämtliche Schultypen sowie berufsvorbereitende Einrichtungen und Förderlehrgänge verfügbar.
Was wir pädagogisch erreichen wollen
Wie wir »Erziehung« verstehen und im Alltag umzusetzen versuchen, wurde weiter oben dargelegt. Eingebettet wird diese Praxis in ein übergeordnetes Ziel: die Erziehung der uns anvertrauten Jugendlichen zu »ganzen Menschen«, d.h. zu offenen, toleranten und lebenstüchtigen jungen Menschen, die nicht auf Versorgung durch andere angewiesen sind und sich nicht an festgefahrene Rollenklischees klammern, sondern sich allen Lebensbereichen stellen, mit denen sie konfrontiert werden. Ausgiebig Gelegenheit zum Üben bietet die Bewältigung des gemeinsamen Alltags, der von den Jugendlichen dann als befriedigend erlebt werden kann, wenn er von Lebensfreude, Besonnenheit und gegenseitigem Respekt getragen ist.
Im Einzelfall ergeben sich die pädagogischen Ziele aus der Problematik der betreffenden Jugendlichen. Sie orientieren sich an ihren Stärken, Fähigkeiten und Neigungen ebenso wie an den vorhandenen Defiziten und an einer Lebensplanung mit Realitätsbezug und Augenmaß, die intellektuelle und emotionale Belastbarkeit und insbesondere die Lebensentwürfe der Jugendlichen selbst zu berücksichtigen hat.
Zur Erziehung zur Selbständigkeit gehört auch, dass den Jugendlichen, wenn sie soweit sind, Gelegenheit zur Ablösung gegeben wird. Dazu bieten wir die Möglichkeit des Außenbetreuten Wohnens an.
Elternarbeit und Kontakt zu den Eltern
In der Regel gehen einer Heimunterbringung tiefgreifende Konflikte, wenn nicht Zerwürfnisse zwischen Eltern und Kindern voraus. Zwar macht es die räumliche Distanz beiden Seiten leichter, wieder aufeinander zuzugehen, weil die Eltern-Kind-Beziehung nun weitgehend entlastet ist von den zermürbenden Alltagsproblemen; die Grundkonflikte jedoch bleiben dabei ausgespart. Zur Vorgeschichte der Heimunterbringung gehört ja in der Regel auch, dass der Grundkonflikt selbst mit Hilfe Dritter, eines Erziehungsberaters oder des Jugendamtes, nicht gelöst werden konnte. Die Heimunterbringung selbst muss als Folge des Scheiterns dieser Versuche betrachtet werden, das die Verantwortlichen zu einem anderen, eingreifenderen Lösungsversuch durch Aufkündigung der Lebensgemeinschaft veranlasst hat.
Es wäre von der Heimerziehung zu viel verlangt, würde man von ihr eine Aufarbeitung von Konflikten erwarten, die im Vorfeld nicht gelungen ist. Insbesondere fehlgelaufene Bindungsprozesse haben in der Regel ihre Ursache in problematischen Erfahrungen der Eltern selbst und sind tief in ihrer Persönlichkeit verankert. Dies umfassend aufzuarbeiten kann nicht Aufgabe der Heimerziehung sein. Ihre Aufgabenstellung hat einen anderen Akzent: Elternarbeit, die gerade in einer kleinen Einrichtung wie der unseren nur in begrenztem Umfang möglich ist, hat die Aufgabe, das Eltern-Kind-Verhältnis zu entkrampfen, in den Eltern das verschüttete Einfühlungsvermögen in ihr Kind wieder zu wecken und damit neue Beziehungsnuancen zu fördern, die die alten pathogenen Beziehungsmuster zumindest teilweise überformen können. Das setzt die Bereitschaft und die Fähigkeit voraus, den Eltern ebenso viel Verständnis und Empathie entgegenzubringen wie ihren untergebrachten Kindern.
Elternarbeit in diesem Sinn muss ergänzt werden durch Arbeit mit dem Kind, dem in kritischer Solidarität eine Auseinandersetzung mit seinem Anteil am Scheitern der Eltern-Kind-Gemeinschaft abverlangt wird. Wenn dies zur Folge hat, dass sich die Beziehung zwischen dem/r Jugendlichen und seinen/ihren Eltern dauerhaft und tiefgreifend ändert und eine von beiden Seiten gewünschte Rückführung in die Familie aussichtsreich erscheint, so ist das Optimum erreicht. Zur Regel oder gar Norm aber kann dies angesichts der verfestigten Persönlichkeitsstrukturen auf Seiten der Eltern und/oder der Kinder, mit denen wir es häufig zu tun haben, aufgrund milieubedingter Gefährdungen im Elternhaus, die durch die Heimunterbringung nicht behoben worden sind, und nicht zuletzt wegen altersgemäßer Ablösungsbestrebungen älterer Jugendlicher nicht erhoben werden.
Besuchsregelungen werden individuell vereinbart. Maximum und bei gutem Eltern-Kind-Kontakt die Regel sind Heimfahrten an jedem zweiten Wochenende und in den Ferien.
Heimerziehung: ein Prüfstand für Erzieher
Erziehung fordert nicht nur die Jugendlichen, sondern in gleichem Maße die Erzieher. Ständige Aufmerksamkeit neigt dazu, sich zu erschöpfen, so dass ein Ausweichen auf Routinen und einrichtungsspezifische Formen von Betriebsblindheit häufig unerwünschte und qualitätsmindernde Begleiterscheinungen der Heimerziehung sind – jedenfalls dann, wenn keine Vorkehrungen dagegen getroffen werden.
Wir versuchen, ein hohes Maß an Aufmerksamkeit in der Erziehungsarbeit durch folgende Maßnahmen aufrechtzuerhalten:
- ein umfassendes Dokumentationssystem, das zur ständigen begleitenden Reflexion zwingt;
- aktueller Austausch bei der täglichen Dienstübergabe;
- kollegiale Beratung in den Erzieherkonferenzen;
- Supervision;
- Fortbildungsangebote und eine heiminterne Fortbildung, wo dies möglich und sinnvoll ist.
